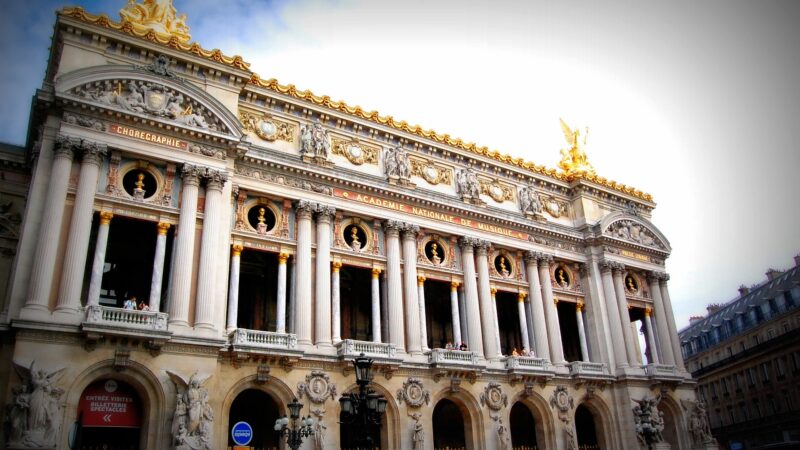Mov:ement: Zwischen Bergidylle und Gesellschaftsanalyse

»Heidi, deine Welt sind die Be-her-ge!« Daran denken vermutlich viele meiner Generation bei dem Stichwort »Heidi«. Zugegebenermaßen bin auch ich als Kind freudig umeinander gesprungen, wenn die Zeichentrick-Serie mal wieder um 19 Uhr auf KiKa lief. Heute – mit 24 Jahren – ruft eine Kinderserie bei mir natürlich nicht mehr diese Emotionen hervor. Ganz anders aber Alain Gsponers Neuverfilmung der Geschichte aus dem Jahr 2015. Denn sie zeigt nicht nur die im Schweizer Ausland romantisierte Bergidylle des Alpenlandes, sondern kann als Gesellschaftsanalyse der damaligen Zeit gelesen werden, die die Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in zwei verschiedene Welten teilte. Und zwischen diesen beiden Welt steht Heidi.
von Lotte Nachtmann
»Heidi« ist neben »Ronja Räubertochter«, »Jim Knopf« und »Wir Kinder aus Bullerbü« eines der bekanntesten Kinderbücher, die im deutschsprachigen Raum abends am Bett vorgelesen werden. Oder zumindest war das Anfang der 2000er in meiner Kindheit noch so. 1880 und 1881 erschienen die beiden Bände der Schweizer Autorin Johanna Spyri: »Heidis Lehr- und Wanderjahre« und »Heidi kann brauchen, was es gelernt hat«. Bei diesen Titeln, die sich heute allerdings meist auf den Namen der Protagonistin beschränken, denkt man* gar nicht, dass solche Bücher auch mehr als 100 Jahre später noch als adäquate Lektüre für den Nachwuchs gesehen werden. Die Geschichte des Waisenmädchens wurde bisher in 50 Sprachen übersetzt und etwa 25 Millionen mal verkauft. Zum Vergleich: »Harry Potter und der Stein der Weisen« ging rund 100 Millionen mal über die (virtuelle) Ladentheke. Da kann Heidi eindeutig mit Harry mithalten. Der Film spielt allerdings nicht in Hogwarts, sondern auf einer einsamen Berghütte in den Bergen, einem Ort, an dem die Menschen damals noch genauso lebten, wie 100 Jahre zuvor und in dem die Industrialisierung noch nicht angekommen war. Gemeinsam ist Harry und Heidi jedoch, dass sie beide Waisenkinder sind (nimmt man* Jim Knopf noch mit ins Boot, dann scheint das ein Theme für erfolgreiche Kinder- und Jugendromane zu sein).
Wer »Heidi« nicht kennt, hat eine Bildungslücke
Mit der Magie und den Gefahren der Zauberer*innenwelt wird Heidi indes nicht konfrontiert. Als klassische Werte, die Kinderbücher noch heute stets diskutieren, stehen natürlich Freundschaft (zu Klara, ihrer Freundin aus Frankfurt, und dem Geissenpeter) und Heimat (die Berge oder die Stadt?) im Vordergrund des Plots, den ich hier nicht noch einmal darlegen möchte, da ich davon ausgehe, dass so ziemlich jede*r in meinem Alter weiß, wie die Geschichte ihren Lauf nimmt. Und wenn nicht, dann schmeißt bitte eure jetzige Sommerlektüre sofort in die Ecke und geht in den nächsten Buchladen. Und kommt erst wieder zu diesem Artikel zurück, wenn ihr eure Bildungslücke aus der Kindheit aufgefüllt habt. Ja, alle Anfang- und Mittzwanziger*innen können sich angesprochen fühlen. Denn »Heidi« kann auch in diesem Alter noch gelesen oder – darum soll es in dieser Kolumne ja eigentlich gehen – angeschaut werden. Denn es sind vor allem zwei Aspekte, die sich auch als Haupthandlung für jeden »Erwachsenen«-Film eignen würden und die jüngste »Heidi«-Verfilmung zu einem so wertvollen Stück Kultur machen.

Wer außer Bruno Ganz?
Zum einen haben wir hier die Rolle des Großvaters, des Almöhis, in der 2015er-Verfilmung gespielt von dem wundervollen Bruno Ganz. Der Almöhi verkörpert natürlich den klassischen einsamen, Menschen meidenden, grantigen alten Schrat. Doch im Almöhi steckt noch etwas anderes: Er ist eine Figur, die zugleich Trauer, Schuld und das vermutlich stärkste menschliche Gefühl – Scham – repräsentiert. Trauer und Schuld für den Tod des Sohnes, der bei der Arbeit auf der Alm ums Leben kam. Scham, diesen Verlust nicht zu verkraften, in einer fast schon archaischen Welt der Schweizer Bergdörfer, in der »Männer noch Männer« waren und keine Gefühle zeigen durften. Eine Scham so stark, dass der Almöhi sich auf die Alm zurückzog, um seiner Trauer und den mitleidigen Blicken der Dorfbewohner*innen zu entkommen. Eine Scham bei dem Blick der kleinen Heidi, seiner Enkelin (Anuk Steffen), die er erst wegschicken will, weil sie ihn an seinen Sohn erinnert und daran, dass er sich die Schuld für den Tod ihres Vaters gibt. Die er dann aber doch nicht wegschickt und die es schafft, das Herz dieses gebrochenen Manns wieder zu flicken. Das Zusammenspiel von Bruno Ganz, der zum Zeitpunkt des Drehs auf Jahrzehnte an Filmerfahrung zurückblicken konnte, und der Laienschauspielerin Anuk Steffen mit ihrem originalen Schweizer Dialekt ist so wundervoll mitanzusehen, dass einem das Herz aufgeht. Sie gehen in einer so vertrauten Selbstverständlichkeit miteinander um, dass die Zuschauer*innen denken möchten, es handle sich tatsächlich um Großvater und Enkelin. Die Leichtigkeit, Natürlichkeit und Naivität, die Anuk Steffen Heidi gibt, könnten keine größeren Gegensätze zur Trauer, Einsamkeit und Verbitterung des Almöhis darstellen, den niemand, aber auch wirklich niemand außer Bruno Ganz hätte spielen können. Und doch finden diese beiden Seelen zusammen und es entsteht eine Liebe, die ihresgleichen in der Filmwelt sucht. Denn der Almöhi und die Berge und in gewisser Weise auch der Geissenpeter – ebenfalls von einem Laienschauspieler (Quirin Agrippi) gespielt – sind Heidis Heimat. Und diese Liebe zur Heimat ist so groß, dass als Heidis Tante Dete (Anna Schinz) sie zur fernen Verwandtschaft nach Frankfurt bringt, das Heimweh so groß wird, dass das kleine Mädchen krank wird.

Oh du freie und enge Bergwelt
Und genau in diesem Kontrast sehe ich die zweite wertvolle Botschaft dieses Films: Denn »Heidi« analysiert nicht nur die Gefühle eines Mädchens, das zwischen den Bergen des Großvaters und der Stadt fast zerrieben wird. Nein, die Figur der Heidi steht sinnbildlich für all die Menschen, die in der Zeit des Übergangs von agrarischer zu industrialisierter Welt unter die Räder geraten sind. Die Alm, das ist die »heile, alte Welt«, in der es keine Tischmanieren, keine Stickarbeiten und keine engen Lederschühchen für Heidi gibt. Es ist aber auch eine enge Welt, in der ein alter Mann sich für seine Trauer schämt, in der ein Mädchen im Rollstuhl keinen Platz zu haben scheint und in der Heidi später einmal niemals die Chancen haben würde, die ihr eine Ausbildung in der Stadt bieten könnten. Aber es ist dennoch eine Welt, in der sich Heidi frei und glücklich fühlt und gar nicht versteht, warum sie dort weg sollte. So wie viele einfache Menschen auf dem Land in Zeiten der Industrialisierung nicht verstanden, wozu sie diesen lauten, dreckigen, maschinellen Fortschritt denn brauchen. Frankfurt am Main und das strenge, stets auf Haltung und Etikette achtende Fräulein Rottenmeier (Katharina Schüttler) stehen als böse, kaltherzige Kontrahent*innen der freien Welt der Berge und der kleinen Heidi bedrohlich gegenüber. Dass Klara (Isabelle Ottmann) erst auf der Alm wieder gesund wird, zeigt nur einmal mehr, auf welcher Seite der Film steht. Als moderner*m Zuschauer*in ist einer*m aus besagten Gründen natürlich bewusst, dass das arbeitsreiche, ärmliche Leben der vorindustriellen Zeit heute kaum mehr eine Alternative mehr zu unserem kapitalistischen Lifestyle darstellen kann. Wie viele gestresste, digital abhängige Millennials derzeit in die Alpen zum Wandern und Detox strömen, beweist jedoch, dass die Alm ihren Charme seit dem ersten Erscheinen der »Heidi«-Bücher nicht eingebüßt hat. Die Schweiz ist heute nicht mehr die Idylle, die der Klassiker vor 140 Jahren gemalt hat, politisch nicht, gesellschaftlich nicht und vielerorts vermutlich auch landschaftlich nicht mehr. Denn so mächtig die Geschichte der kleinen Heidi ist, so mächtig ist sie nun auch wieder nicht, als dass sie den Fortschritt – der nicht mehr aussieht wie das graue Frankfurt 1880 und Fräulein Rottenmeier – hätte aufhalten können. Für ein bisschen Bergidylle, Industrialisierungskritik und herzzerreißende Großvater-Enkelin-Szenen lohnt sich die »Heidi«-Verfilmung von Alain Gsponer allerdings.
Beitragsbild: Der Geissenpeter (Quirin Agrippi) und Heidi (Anuk Steffen). G+J Entertainment Media | © Studiocanal