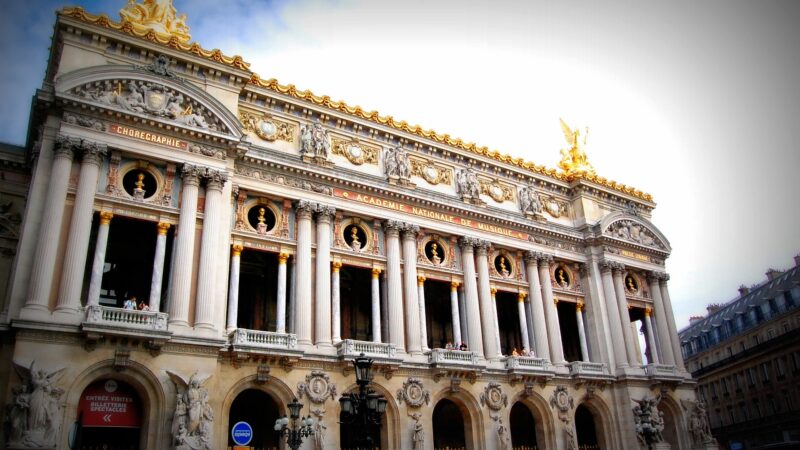Mov:ement: Look Who´s Inside Again – Räume im Film

Entfernte Planeten, exotische Landschaften, futuristische Städte – Film hat die Möglichkeit, uns Dinge zu zeigen, die wir noch nie gesehen haben und uns nicht einmal vorstellen konnten. Doch was passiert, wenn ein Film sich auf das Wesentliche begrenzt, den Handlungsspielraum drastisch verkleinert und uns in einen kleinen, abgeschlossenen Raum verfrachtet? Genau dies möchte ich heute untersuchen.
von Julian Tassev
Ob wir nun mit James Bond auf die Bahamas fliegen, mit Tom Cruise auf einem Wolkenkratzer in Dubai herumkraxeln oder mit Indiana Jones verschollene Tempel plündern – das Kino befriedigt den ewigen Drang nach Abenteuer, Aufregung und dem »Fremden«. Mein Blick auf und meine Beziehung mit Film hat sich in den vergangenen Monaten nochmals drastisch verändert. Auch wenn ich schon immer viel geschaut habe, konnte ich vor allem dieses Jahr endlich große Lücken in meiner »filmischen« Bildung schließen. Ich konnte viele wichtige Klassiker aufholen, die einfach dazugehören, für die man* aber irgendwie nie den richtigen Abend erwischt. Besonders beeindruckt hat mich dabei Sidney Lumets »12 Angry Men« von 1957, ein Kammerspiel, welches bis heute in vielerlei Hinsicht unerreicht ist. Ein junger Mann steht vor Gericht. Er soll seinen Vater ermordet haben. Nach einem kurzen Blick auf den Angeklagten folgen wir der Jury, die in einen abgeschlossenen Raum geführt wird, um über das Urteil zu entscheiden. Die Entscheidung scheint festzustehen, reihum stimmen die Geschworenen für »schuldig«. Nur einer der Männer, Geschworener Nummer acht, ist nicht überzeugt. Er kann selbst nicht exakt in Worte fassen wieso, aber er hat letzte Zweifel. Was nun folgt, sind 90 Minuten knisternde schwarz-weiß-Spannung in der Hitze New Yorks. Die Kamera verlässt den Raum nicht mehr, und wir werden Zeug*innen, wie ein Geschworener nach dem anderen seine eigenen Dämonen bekämpfen muss, um dem Jungen und dessen Zukunft eine angemessene Chance zu geben.
Mit diesem Meisterwerk als Ausgangspunkt möchte ich einen Blick auf diese ganz besondere Art von Film werfen. Es scheint seltsam und gefährlich, sich als Filmschaffende*r mit räumlichen und zeitlichen Begrenzungen selbst Hürden und Probleme aufzustellen, die es nun zu lösen gilt. Manche Geschichten fordern es einfach, bestimmte Genres bieten sich dafür herrlich an. Die Klaustrophobie, die mit solch einer Prämisse einhergehen kann, äußert sich vor allem im Horror gerne. In John Carpenters »The Thing« (1982) stößt ein Forschungs-Team in der Antarktis auf ein seltsames, unbekanntes Wesen, welches die Gestalt anderer Lebewesen annehmen kann. Sie erkennen die Gefahr, falls dieses »Ding« einen Weg in die Zivilisation findet. Sie wissen, dass bald ein neues Team samt Helikoptern eintrifft und dass jeder von ihnen schon längst das »Ding« sein kann. Ein intensives, ohne Computer-Bilder gestaltetes Katz-und-Maus-Spiel auf der kleinen Forschungsstation beginnt.
Manchmal versteckt sich die eingrenzende Prämisse auch schon im Film-Titel: »Panic Room« (2002), »Room« (2015) oder »Green Room« (2015) spielen sich alle – wer hätte das gedacht – größtenteils in einem kleinen Raum ab. Die Herausforderung besteht hier also darin, mit filmischen Mitteln den Raum möglichst abwechslungsreich in Szene zu setzen. Was Regisseur Lenny Abrahamson mit »Room« macht, werde ich auch nie vergessen können. Der kleine Jack lebt mit seiner Ma sein ganzes Leben im »Raum«, einem kleinen Schuppen mit einem Dachfenster und schalldichten Wänden. Tagsüber spielen sie, wobei die Vorstellungskraft hier die meiste Arbeit leisten muss. Nachts muss sich Jack oft im Schrank verstecken, da Old Nick kommt und sich an seiner Ma vergeht. Wir sehen die ausweglose Grausamkeit der Situation durch Jacks Kinderaugen, was es ehrlich gesagt noch schlimmer macht. Nachdem wir den »Raum« für längere Zeit verlassen haben, und die beiden zum Schluss dorthin zurückkehren, wird dieser als wesentlich kleiner gezeigt. Erst jetzt fällt uns auf, wie sehr sich die beiden an ihr Leben gewöhnt hatten, und wie »normal« der Raum zuvor wirkte.
Der Drang nach Freiheit und Selbstbestimmung ist für uns ganz normal und wir sympathisieren wie selbstverständlich mit diesen Figuren und deren Kampf. Manchmal wird die Gefangenschaft aber auch so stark verinnerlicht, dass es Teil des Charakters wird. So zum Beispiel in zwei legendären Gefängnis-Filmen: »Papillon« (1973) und »The Shawshank Redemption« (1994). In »Papillon« wird der titelgebende Pariser Ganove für einen Mord, den er nicht begangen hat, auf eine berüchtigte Gefängnisinsel in Französisch-Guyana verbannt. Schon auf dem Weg lernt er den Fälscher Louis Dega kennen, höchst intelligent, aber körperlich den harschen Bedingungen nicht gewachsen. Aus einer Abhängigkeit entwickelt sich eine innige Freundschaft, und gemeinsam versuchen sie jahrelang, aus der grünen Hölle zu entkommen. Zum Schluss hat Dega allerdings den Willen verloren; er sieht für sich keinen Platz mehr in der »echten« Welt. Er tut alles, um seinem Freund zur Flucht zu verhelfen, bleibt aber schließlich zurück, die Routine ist sein neues Leben. Ähnlich geht es auch dem alten Brooks im »Shawshank«-Gefängnis. Als er nach 50 Jahren entlassen werden soll, ist es ein erster Instinkt, jemanden zu verletzen, um inhaftiert zu bleiben. Auf die guten Worte seiner Freunde hin verlässt er schließlich das Gefängnis, kommt in einer Art betreutem Wohnen unter und muss in einem Supermarkt als Einpack-Hilfe ran. Im Gefängnis war er der angesehene Verwalter der Bibliothek, draußen ist er ein Niemand. Die neuen Umstände werden schon bald zu viel für ihn, und so nimmt er sich das Leben.
Während der klassische »Gefängnis«-Film hier also durchaus reinpasst, gibt es aber auch noch eine extreme Ausprägung dieser Art von Film zu besprechen. In Joel Schumachers »Phone Booth« (2002) wird der schmierige Autor Stuart, gespielt von Colin Farrell, mitten in New York in einer Telefonzelle von einem Scharfschützen gefangen gehalten. Dieser droht Stuart damit, seine Affäre an die Öffentlichkeit zu bringen, sollte er den Hörer auflegen. Was anfangs wie ein schlechter Scherz klingt, wird bitterer Ernst, als tatsächlich die ersten tödlichen Schüsse fallen. In »Buried« (2010) wird der LKW-Fahrer Paul im Irak entführt und lebendig begraben. Nur mit einem Feuerzeug und einem Handy ausgestattet kämpft er ums Überleben. Im französischen Film »Oxygen« aus diesem Jahr erwacht Mélanie Laurent in einer futuristischen Gefrier-Kammer, ohne jeglichen Erinnerungen. Keiner dieser Filme ist unbedingt erfolgreich in dem, was sie tun, aber ich unterstütze jede neue kreative Idee, die eine starke filmische Inszenierung fordert. Wenn dabei so etwas wie Danny Boyles »127 Hours« herauskommt, immer her damit!
Und somit bin ich bei meinem letzten und jüngsten Beispiel angelangt. Der Film, von dem auch der Titel dieses Artikels stammt. Mein bisheriges Highlight des Filmjahres 2021 – auch wenn er mit keinem anderen Film vergleichbar ist – und das vielleicht wichtigste Kunstwerk über die Pandemie und die unzähligen Lockdowns: »Bo Burnham: Inside« erschien am 30. Mai auf Netflix und ich habe ihn bereits viermal gesehen, das dazugehörige Album unzählige Male gehört. Bo Burnham begann seine Karriere mit 16 Jahren mit lustigen Songs auf Youtube (die übrigens alle noch da sind, mit Millionen von Views), ging dann als Stand-Up Comedian auf Tour. Es ging bei ihm schon immer viel um Selbstreflexion, psychische Probleme und gesellschaftliche Missstände, vor allem mit Bezug auf Social Media. Das alles drückte er hauptsächlich in satirischen, komischen Musikstücken aus. Doch der Druck einer erneuten großen Show wurde ihm zu viel, er zog sich mit Mitte 20 aus dem Business zurück. Letztes Jahr sah ich ihn erstmals in einer tollen Nebenrolle in Emerald Fennells »Promising Young Woman« und mir war klar, dass ich von diesem Menschen mehr sehen möchte. Ich wurde in jeder Hinsicht bedient.
Im Januar 2020 war Bo bereit, wieder eine Show auf die Beine zu stellen und auf Tour zu gehen. Doch wie es das Schicksal wollte, kam eine klitzekleine globale Pandemie dazwischen. Also sattelte Netflix kurzerhand um, gab Bo ein Jahr lang Zeit, irgendwie von Grund auf und auf sich gestellt in den eigenen vier Wänden ein »Comedy«-Special zu kreieren. Was dabei herauskam, ist pures Gold. In unter 90 Minuten verarbeitet Bo vor unseren Augen dieses seltsam entschleunigte, aber gleichzeitig so unwirklich schnell vorbeigezogene Jahr mit einem Dutzend genialer, kritisch-ironischer Songs, die erst zum Lachen anregen, nur um dann umzuschwingen und eher ein Stirnrunzeln und die ein oder andere Träne hervorbringen. Es geht um seine Depressionen, sein Image und seine seltsame Karriere. Ganz nebenbei stichelt er gegen Big Data, Social Media-Influencer, Fake News und Cancel Culture. Eben die Themen, die seine Zielgruppe von 18-30-Jährigen beschäftigen. Und das Beste: wie er sein relativ kleines Studio in Szene setzt. Mit Lichtern, Instrumenten und Kamera-Tricks wird aus der Bude eine Konzerthalle, ein Lagerfeuer oder ein Fotostudio. Pure, ungefilterte Kreativität. Wenn ich es eines an dem Film aussetzen könnte, dann dass er mir vorgehalten hat, wieviel Zeit ich doch verschwendet habe.
Beitragsbild: © Netflix