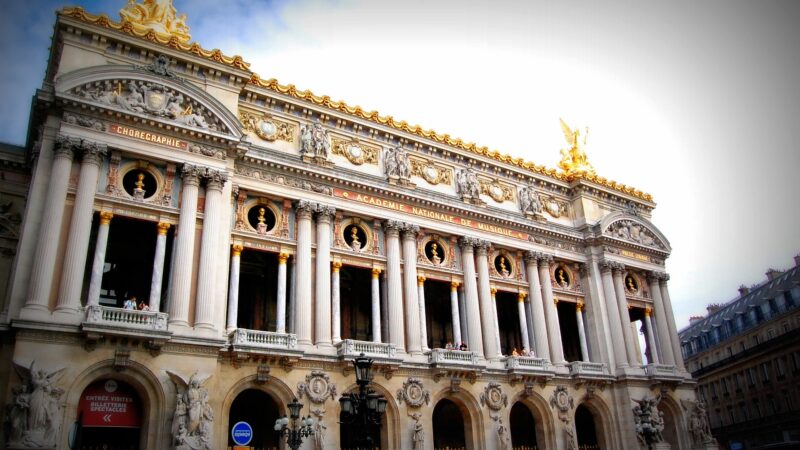Mov:ement: Xavier Dolan – Art House extraordinaire

Mit gerade Mal Anfang 30 ist der Québecer Xavier Dolan bereits Stammgast auf den renommiertesten Filmfestspielen der Welt. Egal ob in Cannes, Toronto oder Venedig: Dolans Filme werden mit Lob und Preisen geradezu überhäuft. Die ein oder andere Person wird sich nun vermutlich fragen, wie ein Typ, der nicht recht viel älter ist als man* selbst, das geschafft hat. Dolans Erfolgsrezept: Wunderschön intime, von zwischenmenschlichen Beziehungen handelnde und die Banalität des Lebens feiernde Filme auf die große Leinwand bringen.
von Celina Ford
Vom Wunderkind zum gefeierten Künstler
Xavier Dolan wurde 1989 in Montreal, Québec, geboren. Schon als Kind probierte er sich im Film-Metier aus und stand nicht nur als Schauspieler vor der Kamera, sondern auch als Synchronsprecher hinterm Mikrofron (Dolan lieh unter anderem Ron Weasley seine Stimme in der Québec-französischen Synchronisation der »Harry Potter«-Reihe). Doch Dolans Hunger nach wahrer Selbstexpression konnte das allein nicht stillen. Um die förmlich aus ihm heraussprudelnde Kreativität in eine konstruktive Richtung zu lenken, setzte sich Dolan mit 16 an die metaphorische Schreibmaschine und verfasste das Drehbuch zu seinem ersten, semi-autobiographischen Film »J’ai tué ma mère« (»Ich habe meine Mutter getötet«).
Der Film erzählt die Geschichte des gleichaltrigen Hubert und seiner Mutter Chantale. Obwohl ihre Beziehung während Huberts Kindheit harmonisch war, gleicht sie nun in der Pubertät und nach der Trennung der Eltern eher einem Scherbenhaufen. Hubert ist nur noch genervt von seiner Mutter und ihren Eigenheiten. So kann er beispielsweise kaum seinen Ekel verbergen, wenn ihr der Frischkäse beim Abendbrot an der Wange klebt oder seinen Zorn kontrollieren, wenn sie sich während des Autofahrens schminkt. Die Beziehung ist so explosiv, dass selbst die kleinste Meinungsverschiedenheit reicht, um einen handfesten Streit vom Zaun zu brechen. Dennoch liebt Hubert seine Mutter, was er in einer Art Videotagebuch festhält. Jedoch nicht genug, um ihr beispielsweise zu eröffnen, dass er einen festen Freund hat. Im Laufe des Films und über viele Höhen und Tiefen hinweg merken Mutter und Sohn jedoch, dass sie einander brauchen und wagen tatsächlich so etwas wie einen Neustart. So kann’s laufen: Die einen quälen sich als 16-Jährige mit Gedichtinterpretationen herum, die anderen schreiben Drehbücher.

»J’ai tué ma mère« feierte 2009 seine Premiere bei den Filmfestspielen in Cannes in der Kategorie Junge Regisseure. Da Dolan nicht nur das Drehbuch schrieb, sondern zudem Regie führte, die Hauptrolle übernahm und generell fast in jedem Department seine Finger im Spiel hatte, wurde er schon bald als das kanadische Wunderkind betitelt. Zurecht, wie die Zukunft zeigen würde.
Sein zweiter Film, »Les amours imaginaires« (»Herzensbrecher«), lief ein Jahr später ebenfalls in Cannes. Gleiche Formel: Dolan schrieb das Drehbuch, führte Regie und übernahm die Hauptrolle in einem Streifen, der von zwei Freunden handelt, die für ihre Liebe zum gleichen Typen fast ihre Freundschaft aufs Spiel setzen. Zugegebenermaßen steht aber auch ein wie von einem klassischen griechischen Bildhauer gemeißelter Adonis im Zentrum dieser Dreiecksbeziehung. Da kann man* das manchmal fast schon peinliche Buhlen um seine Person sogar verstehen.
Dolan war, wie man* so schön sagt, künstlerisch on a roll. 2012 noch mit »Laurence Anyways«, einem Drama über Geschlechtsangleichung und dem Kampf um den Erhalt einer Beziehung in den Kinos vertreten, überraschte der Québecer 2013 mit einem Genreswitch, nämlich dem Thriller »Tom à la ferme« (»Sag nicht, wer du bist!«). 2014 erschien mit »Mommy« ein aufrüttelndes Familiendrama über die Beziehung zwischen einer Mutter und ihrem verhaltensauffälligen Sohn, für welches er den Jury Preis in Cannes gewann. 2016 knüpfte Dolan mit »Juste la fin du monde« (»Einfach das Ende der Welt«) an die Thematik der gestörten familiären Beziehungen an. Für dieses Werk konnte er sogar den Grand Prix in Cannes einheimsen. 2018 erschien mit »The Death and Life of John F. Donovan« dessen erster rein englischsprachiger Film. Und zuletzt schuf Dolan mit »Matthias & Maxime« (2019) eine Ode an die Freundschaft.

Ach ja, ganz nebenbei: Dolan ist immer noch als Schauspieler und Synchronsprecher in anderen Filmen tätig. So war er beispielsweise nicht nur in »Boy Erased« (2018), sondern auch in »Bad Times at the El Royale« (2018) und in »Es Kapitel 2« (2019) zu bestaunen.
Und nicht nur das. Für Musikvideos ist er mittlerweile ein gern gebuchter Regisseur. Das Video zu »Hello« von Adele, das mittlerweile an der drei Milliarden Views-Marke kratzt, ist von Dolan. Und auch das kontroverse Video zu »College Boy« der französischen Band Indochine stammt aus der Feder des Québecers.
So geht modernes Arthouse-Kino
Der »Wow, so jung und schon so talentiert«-Effekt war vielleicht für die ersten Filme ein valides Argument, um Dolans frühen Erfolg zu erklären. Doch für die späteren Werke in seiner Karriere kann man* diese von manchen schon fast zur Ausrede degradierten Tatsache nicht mehr anführen. Obwohl ihm sein junges Alter zwar zu Beginn seiner künstlerischen Laufbahn sicherlich half, einige mehr Augen auf seine Werke zu lenken, zeigte er bereits mit Anfang 20 eine klare Handschrift, die er seitdem von Film zu Film immer weiter verfeinerte. So gibt es einige Merkmale, die sofort verraten, dass man* gerade einen Dolan-Streifen guckt.
Das offensichtlichste Merkmal: Die Schauspieler*innen. Dolan bevorzugt es, immer wieder die gleichen Akteur*innen für seine Filme einzusetzen. So zählen beispielsweise Anne Dorval, Suzanne Clément, Monia Chokri, Nils Schneider und er selbst natürlich (manchmal auch nur in Cameo-Rollen) zum festen Ensemble. Und dieses Ensemble muss vor allem eins sein: Textsicher. In Dolans Filmen überschlagen sich nämlich die energischen und hoch emotionalen Dialoge regelmäßig und enden in einem großen Buchstabenquaos.
Doch wovon handeln diese Dialoge? Und wer sind die Charaktere, die sie vortragen? Grundsätzlich drehen sich Dolans Filme fast immer um Figuren in der Umgebung Québecs, die an einem Scheideweg in ihrem Leben stehen. Sei es Selbstverwirklichung in Form einer Geschlechtsangleichung, das Verlassen des gewohnten Umfelds, Familienkonflikte, Spannungen im Freundeskreis oder das Auseinanderbrechen von Beziehungen – es sind Stationen im Leben der Protagonist*innen, die diese nachhaltig verändern. Oftmals werden anhand dieser Themen auch Beobachtungen über Sexualität und Gender angestellt, womit man* einige von Dolans Filmen auch dem »Queer Cinema« zuordnen kann.
Neben diesen erzählerischen Merkmalen ist Dolans Touch aber auch auf technischer Ebene klar erkennbar. Shots vom Hinterkopf der Figuren oder die Positionierung der Kamera oberhalb des Scheitels sind in fast jedem Film zu finden und erzeugen so eine gewisse Distanz zu den Charakteren. Die Wahl, die Darsteller*innen im Zentrum einer Sequenz oder ganz bewusst am Bildrand zu zeigen, übersetzt harmonische oder konfliktgeladene Gefühle in einer räumlichen Art und Weise. Und mit dem häufigen Einsatz von Slow Motion-Shots wird das Innenleben und die subjektive Wahrnehmung der Protagonist*innen fühlbar gemacht.
Nur für wenige Sekunden eingeblendete, expressionistische und symbollastige Bilder, die den Werken einen fast schon surrealen Effekt verleihen, gehören ebenfalls zur Grundausstattung in Dolans Werkzeugkasten. So laufen Huberts als Nonne aufgemachte Mutter in »J’ai tué ma mère« (2009) blutige Tränen über die Wangen und in »Laurence Anyways« (2012) schlüpft ein Schmetterling aus dem Mund der titelgebenden Figur. Am experimentellsten ist jedoch vermutlich der Film »Mommy« (2014), der fast die gesamte Spielzeit im iPhone-Hochformat verbringt, nur um dann in einer phänomenalen Szene, die den ganzen Film atmen lässt, in das reguläre Format überzugehen.

Was bei anderen Regisseur*innen vermutlich nicht immer ganz oben auf der Priority-Liste steht, ist für Dolan mindestens genauso wichtig wie die richtige Kameraeinstellung. Man* merkt, dass der Québecer viele Stunden damit verbringt, sich Gedanken um die Musik- und Farbwahl zu machen. Die oft kunstvollen Einstellungen werden entweder mit einem Mix aus melancholischem Pop oder Elektro untermalt oder in besonders bedeutsamen und spannungsgeladenen Szenen auch mit bekannten klassischen Werken begleitet. Einige von Dolans Filmen verwenden limitierte Farbpaletten, um dadurch zusätzlich Emotionen auszudrücken. So verbildlichen beispielsweise die Bonbonfarben in »Les amours imaginaires« (2010) die Verliebtheit der beiden Hauptdarsteller*innen und die Sepiatöne in »Tom à la ferme« (2013) die Tristesse, die den Protagonisten umgibt.
Obwohl das Arthouse-Kino oftmals einen bitteren und hochnäsigen Beigeschmack haben kann, kommt dieses Gefühl bei Dolans Werken nie auf. Gezeigt werden normale Menschen in Situationen, die jede*r selbst erlebt (hat) oder zumindest so realistisch sind, dass man* durchaus jemanden kennen könnte, auf den*die die Geschichte zutrifft. Dennoch ist jeder Film aufs Neue ein kleines Experiment, das jedoch nicht auf eine erzwungene Weise verkünstelt wird. Das macht Dolans Kino nicht nur laut und bunt, sondern auch unheimlich authentisch, nach- und eindrücklich zugleich. Die Werke des Québecers über die Höhen und Tiefen des Lebens halten genau die richtige Balance zwischen Realismus und Symbolismus und verwandeln das vermeintlich banale Alltägliche in ein wunderschön anzusehendes, melancholisches und zum Nachdenken anregendes Leinwandspektakel.
Hier ein Vorgeschmack auf Dolans Filmographie:
Titelbild: © Vogue