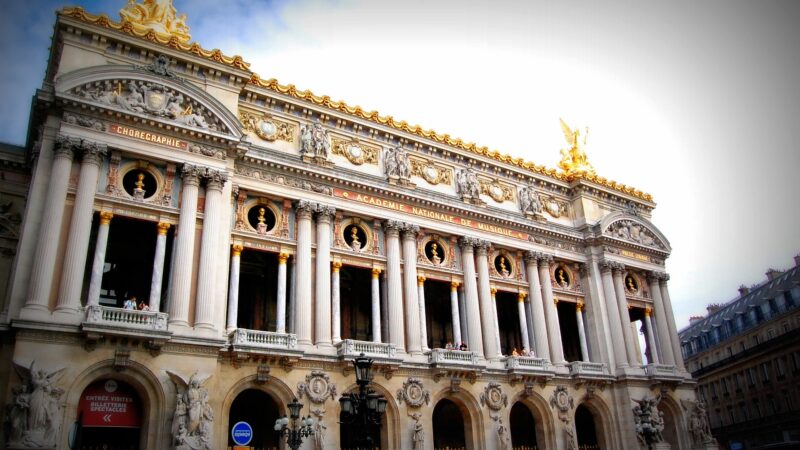Mov:ement: Wir Kinder vom Bahnhof Zoo – Ein Vergleich

Am 19. Februar dieses Jahres startete die Neuauflage einer der berühmtesten persönlichen Geschichten Deutschlands, Christiane F.s »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo«, auf Amazon Prime Video. Kaum ein anderer Stoff (haha) blieb so lange berühmt und berüchtigt; das Buch wird teilweise immer noch in Schulen gelesen, der 1981er Film von Uli Edel wurde zum Kult-Hit. Drogenkonsum unter Jugendlichen ist nach wie vor ein Problem. Passend zum 40-jährigen Jubiläum des Films dachten sich also die Macher*innen der Serie: Jetzt nochmal schön die Cashcow melken.
von Elias Schäfer
Es ist 1978: Christiane Felscherinow, ein 15-jähriges Mädchen aus der Berliner Gropiusstadt, sagt als Zeugin in einem Verfahren gegen einen Mann aus, der sie und andere Minderjährige für Sex mit Heroin bezahlt. Auf den Fall wird der Journalist Horst Rieck aufmerksam, der schließlich zusammen mit seinem Kollegen Kai Hermann anfangs eine zwölfteilige Reportage im Stern über sie und basierend auf ihren Erzählungen verfasst, die schließlich als vollständiges Buch namens »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo« veröffentlicht wird und einschlägt wie ein Speedball: Auf einmal ziert Christianes Gesicht sämtliche Zeitschriften, sie wird von Talkshow zu Talkshow geschickt und das Buch in den Lektürekanon sämtlicher Schulen aufgenommen.
Es wird zum meistverkauften und meistdiskutierten Werk der Bundesrepublik, wird sogar in zahlreiche weitere Sprachen übersetzt und zeigt eine Problematik auf, die bis dahin verpönt war und unter Verschluss gehalten sollte: Selbst im reichen Westen gibt es sozial abgehängte Jugendliche, die in einen Teufelskreis aus Prostitution und Drogenkonsum hineinrutschen und nicht mehr herauskommen (maximal kurzzeitig, wenn eine große Zeitschrift auf sie aufmerksam wird). Die Kurfürstenstraße und der Bahnhof Zoologischer Garten werden zu Synonymen von verfehlter Drogenpolitik und einer No-Future-Generation. Quasi gesetzlose Orte, an denen Jugendliche in der Diskothek Sound feiern gehen und in verdreckten Bahnhofstoilettenkabinen ungestört Heroin spritzen konnten und wo Businessmänner Kinder von der Straße abgriffen, um sie gegen Bezahlung zu vergewaltigen. Und das mitten in Mitte. Natürlich wurde der Bahnhof Zoo somit auch zum Ort der Faszination, der etwas Dreckiges, Verbotenes ausstrahlte und viele Schaulustige anzog.
Apropos Schaulustige: Spätestens seit dem Erfolg von »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo« sind Drogengeschichten auch in Film und Fernsehen eine beliebte Thematik. Während davor hauptsächlich Cop-Movies Drogensüchtige darstellten – natürlich unter der Prämisse, dass auf sie seitens der Staatsgewalt Jagd gemacht wird – erfuhr jetzt vor allem eine ästhetisierte Form, die harte Schicksale und den menschlichen Verfall auf eine künstlerisch hochwertige Weise darstellt, hohe Popularität. Abseits des 1981er Films über Christiane F. waren die 1990er auf jeden Fall die Dekade für filmische Junkie-Darstellungen (auch weil die florierende Grunge-Szene rund um Kurt Cobain und den Alice in Chains Frontsänger Layne Staley sehr auf Heroinkonsum fixiert war): »The Basketball Diaries« aus dem Jahre 1995 mit einem jungen Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle erzählt die Lebensgeschichte des Autors Jim Carroll, der ebenfalls als Jugendlicher dem Heroin-Teufelskreis verfiel und sich nur durchs Schreiben davon lösen konnte.
In »Pulp Fiction« (1994) gönnt sich John Travolta auch eine gute Ladung des Stoffs, unvergessen ist natürlich auch die Szene, in der Uma Thurman auf Kokain überdosiert. Larry Clarks und Harmony Korines »Kids« zeigt die schlimmsten Seiten einer verkorksten Jugend. Den 2000er Film »Requiem for a Dream« mit Jared Leto zähle ich auch noch hinzu, der vom zunehmenden sozialen Abgesang vier Drogensüchtiger erzählt. Und schließlich natürlich »Trainspotting« (1996), schlichtweg der Vorzeigefilm, wenn es um Heroin geht, dessen Szenen und Stil sich permanent in die Netzhaut einbrennen. Heroin und Popkultur gehen somit seit Jahrzehnten Hand in Hand, sei es anhand der Eskapaden des Skandalpaares Sid Vicious und Nancy Spungen, dem Heroin chic der Modewelt, und natürlich auch der Geschichte der Christiane Felscherinow, die über 40 Jahre danach immer noch Aktualität genießt und die mittlerweile fast 60-jährige Frau immer noch nicht ganz in Ruhe leben lassen kann.
Die Umsetzungen des Stoffs

Der von Uli Edel (bekannt z.B. für »Der Baader-Meinhof-Komplex«) gedrehte Film ist gleich auf mehrere Arten interessant: Er wurde an Originalschauplätzen gedreht, ist komplett Low-Budget, konnte sich aber trotzdem die Unterstützung des Megastars David Bowie sichern, der zur damaligen Zeit in Berlin lebte und selbst so einigen Drogen frönte. Die Laiendarsteller*innen rund um Natja Brunckhorst (Christiane) und Thomas Haustein (ihr Freund und selbst »Stricherjunge« Detlef) lernten ihn sogar kennen. Diese Darsteller*innen sind übrigens auch alle im gleichen Alter wie die damalige Truppe der realen Christiane. Die 14-jährige Natja stolpert hier total verloren durch die Berliner Drogenszene, durchs Sound, schminkt sich älter, tätowiert sich etwas Krakeliges auf die Hand, hockt in total verdreckten Toiletten, schnorrt sich benutzte Spritzen von einem komplett abgeranzt aussehenden Junkie, prostituiert sich, kotzt bei einem kalten Entzug die Wand voll, stirbt fast. Trotzdem war Frau Felscherinow bei der Premiere so unzufrieden mit Brunckhorsts Leistung, dass sie den Kinosaal verließ.
Klar, eine gewisse Ästhetisierung muss bei einem Kinofilm vorhanden sein, um ihn überhaupt ansehen zu können, aber Uli Edel machte in seiner Darstellung der Drogenclique ziemlich viel richtig: Alleine die Auftritte von Christiane, Detlef, Axel oder Babsi sind ziemlich überzeugend und wahrscheinlich relativ wahrheitsgetreu, bei der Figur des Jungen namens Leiche (gespielt von Rainer Woelk) frage ich mich bis heute, wie man* so aussehen kann. Der Film ist eine schonungslose Milieustudie, die nichts schönt, sondern so abschreckend, ekelhaft und schmuddelig wirkt, wie eben ein Film über konsumierende und sich prostituierende Jugendliche sein kann. Einige Szenen wurden sogar illegal gedreht, wobei Thomas Haustein in einem kürzlichen Interview mit dem YouTuber $ick eine nette Anekdote parat hatte: Die Stelle, in der eine alte Frau in die Toilette kommt, während der Junkie sich die Spritze in den Hals rammt, war so nicht geplant; die Dame trat einfach so hinein, ihr Schock war also nicht gespielt.
Kommen wir aber nun zur Neuauflage auf Amazon Prime Video, die produktionstechnisch das genaue Gegenteil zum Film darstellt. Als Amazon Produktion hat die Serie natürlich ein um ein vielfach größeres Budget, und das ist merklich zu sehen. Die Sättigung wurde auf zehn hochgeschraubt; so farbenfroh habe ich noch nie etwas eigentlich Deprimierendes gesehen. Die Bilder sind so gestochen scharf und die Darstellung so modern, dass ich erstmal überlegen musste, ob diese Serie wirklich in den 1970ern stattfinden soll. Verantwortlich für die Konzeption und Umsetzung ist die Drehbuchautorin Annette Hess, die auch schon die »Ku’damm« Fernsehfilme schrieb. Hier besteht die Clique nicht mehr aus Laiendarsteller*innen, sondern in den Startlöchern stehenden Jungschauspieler*innen, die wahrscheinlich allesamt eine große Zukunft vor sich haben – und allesamt schon erwachsen sind. Richtig, die eigentlich 13- bis 15-Jährigen werden von Anfang 20-Jährigen gespielt, weshalb die durch die aalglatte Produktion eh schon fehlende suspension of disbelief – abseits der überzeugenden Lea Drinda – ziemlich flachfällt.
Insgesamt muss die schauspielerische Leistung von Jana McKinnon (Christiane), Lena Urzendowsky (Stella), Michelangelo Fortuzzi (der nach Detlef modellierte Benno) und der schon genannten Lea Drinda (Babsi, die jüngste Drogentote Berlins) trotzdem hervorgehoben werden: Fachlich gesehen wird hier absolut nichts falsch gemacht und wirkt auch nicht typisch cringy deutsch, sondern eben kompetent und modern. Es ist deutlich zu sehen, dass hier die Zukunft des deutschen Films auftritt. Jeder Shot mit den Darsteller*innen ist durchgestylt und durchchoreografiert, die Haare sitzen und sind voluminös, das Make-Up sieht mehr nach Heroin chic-Supermodel als nach verkorksten frühpubertierenden Jugendlichen aus. Hinzu kommen einige surreale Besonderheiten wie Babsis drogenbedingte Realitätsverzerrung, Schwebeszenen im Sound, gleich in der ersten Folge ein weirder Einstieg mit Christiane und David Bowie im Privatjet sowie ein abstürzender Aufzug. Die Kirsche auf der schmalzigen »wir erleben gerade den Höhenflug unseres Lebens«-Torte ist allerdings eine Szene, in der die Gruppe ein Kettenkarussell kapert und einfach mal so lachend durch die Berliner Nachtluft rotiert.
1981 vs. 2021: Wie lassen sich Film und Serie vergleichen?

Solche Szenen sind nur ein Teil der Probleme, die ich mit der Serie habe. Allgemein ist alles glattgeleckt bis zum Gehtnichtmehr, ästhetisiert, schrill-steril, bunt – ergo komplett unpassend in der Darstellung des Elends von Jugendlichen Mitte-Ende der 1970er Jahre. Dass die Wahl auf solch eine Art der Gestaltung fiel, wird damit erklärt, dass die Jugendlichen rund um Christiane die Welt um sich herum so sehen, da sie dank des Heroins permanent high sind. Dies ist meiner Meinung nach eine schlechte Ausrede. Wäre dies als vereinzelt eingesetztes Stilmittel benutzt worden, okay, meinetwegen, aber die Serie durchgehend in diesem Stil zu halten, ist nicht nur qualitativ scheiße, sondern auch noch hochgradig verantwortungslos. Augenscheinlich gibt es bei dieser Serie drei Zielgruppen: Leute, die den dort zelebrierten »Berliner Lifestyle« als absolut geil abfeiern, jüngere Menschen, die zum ersten Mal wirklich mit so einer Thematik in Berührung kommen sowie Nostalgiker*innen, die schon den Film und das Buch kannten. Für die beiden letzteren Gruppen ist diese Serie schonmal total ungeeignet; vor allem als potentielle Suchtprävention kann schon der Film aufgrund der doch leichten Idealisierung der Figur Christiane nur bedingt, die Serie aber überhaupt nicht gesehen werden. Jede*r, der*die sich den Spaß gibt und sich des Zerstörungspotentials von Drogen nicht wirklich bewusst ist, muss doch denken, dass Heroin der heißeste Scheiß ist, denn bis auf ein paar halbherzige Entzugs- und Trauerszenen werden keine wirklichen Konsequenzen des Konsums aufgezeigt.
Ein Medium, das eine Drogenthematik aufarbeitet, muss theoretisch nicht lehrreich sein. In dieser Serie geht es jedoch um Kinder, die abstürzen, und sie ist von der Aufmachung und des Marketings her an eine Teenager-Zielgruppe gerichtet. Sobald diese Punkte hinzukommen, liegt auch eine gewisse Verantwortung auf den Macher*innen, die Thematik filmisch so darzustellen, dass diese nicht vordergründig ästhetisch anspruchsvoll und durchgestylt ist, sondern – ich will nicht einmal von Bildungsauftrag sprechen – zumindest halbwegs realistisch porträtiert wird. Dem Buch zufolge war das Leben der jungen Christiane F. nicht dieses funky Zuckerschlecken, wie es in der Serie so wirkt. Es war ein Leben voller Leid, einem alkoholkranken Vater (der im Film gar nicht vorkommt, in der Serie aber viel zu jung wirkt) und natürlich, idealisierten Höhenflügen, aber schlussendlich inklusive dem doch immer härteren Fall. Dieser Teufelskreis wird in der Serie aber – bis auf die Tode der neuen Figur Axel und Babsi – relativ konsequenzenlos dargestellt. Der Verfall der Figur Christiane F. besteht aus verwaschener Mascara und einer Puscheljacke, die ein bisschen dreckig wird, und mit der sie optisch mehr Paris Hiltons Chihuahua gleicht denn einer im Drogensumpf versunkenen, mittellosen Jugendlichen. Die Kleidung wurde den Macher*innen zufolge wirklich aus Christianes Leben entnommen, allerdings trug sie diese Fimmel nicht mit 14 auf dem Straßenstrich, sondern später, als sie schon Geld und Ruhm besaß.
Die Szene, die mich mit der Serie jedoch wirklich abschließen ließ, war eine zelebrierte Verhöhnung sämtlicher Kinderprostituierten weltweit: In einer skurrilen Montage gehen Christiane, Stella und Babsi Hand in Hand auf den Strich, springen fröhlich herum, lachen, und zocken wie richtige Businessfrauen die dreimal so alten Freier ab. Vor allem Stella wird auf einmal zur coolen Zuhälterin, die andere Kinder an Freier verhökert und nur bei ihrer kleinen Schwester Halt macht, die plötzlich auch mitmachen will. Was sollte überhaupt diese Szene? Da kommt ein kleines Kind in Netzstrümpfen und Schminke auf den Strich und wird von ihrer großen Schwester irgendwie weggeschickt. Sollte das drollig und süß sein? Das ist ein weiterer Punkt, der die Serie vom Film negativ unterscheidet: Der Film folgt einem gewissen Narrativ, der zunehmende Verfall der 14-Jährigen wird gut gezeigt. Szenen, die eine gewisse Wirkung haben sollen, haben sie auch. Die Serie jedoch – neben all der gewollten Ästhetisierung der Thematik – baut einfach nur Szenen in einem l’art pour l’art Stil ein, der nur als absichtlich ignorant gewertet werden kann. Irgendetwas passiert, alles sieht cool aus, nichts hat eine Nachwirkung – Repeat.

Eigentlich sollte es ein Vergleich werden und kein Verriss. Je mehr ich jedoch darüber nachdenke, desto schlechter finde ich die Serie, als ich den Film gut finde. Das Einzige neben den Schauspieler*innen, was der Serie zugute gehalten werden kann, ist, dass das Thema sich wirklich erst in einem seriellen Rahmen entfalten kann, da dem Film einfach die Zeit dafür fehlt und er doch mehr oder minder abrupt endet. Der Film ist allerdings in seiner zweistündigen Laufzeit viel mehr dem Ur-Stoff verbunden, als die Serie es in acht mal 50 Minuten schafft. Verständlicherweise wollten einige Charaktere der damaligen Zeit nicht mehr in der Neuauflage vorkommen (irgendwann sollten die Jugendsünden auch mal ruhen dürfen), aber obwohl auch die neu eingeführten Charaktere in der Serie auf realen Personen basieren, fühle ich null mit ihnen mit. Ich habe die Serie innerhalb von zwei Tagen fertiggeschaut, aber nicht, weil sie so sehr catcht, sondern weil sie einfach weggeguckt werden kann – wofür sie auch wahrscheinlich konzipiert wurde. Egal ob beim Frühstück, beim nachmittäglichen Rumlümmeln oder kurz vor dem Einschlafen; die Viewing Experience ist harmlos, tut nicht weh, kann so ganz nebenbei vollzogen werden. Wenn ich allerdings nur daran denke, den Film zu einer anderen Tageszeit als spät abends hochkonzentriert anzusehen, kommt mir sofort in den Kopf, dass das eine schlechte Idee wäre.
Trotz der schlechten Kritiken, die auf Amazons »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo« einprasseln, rattert die Geldmachmaschinerie unaufhörlich: In Berlin rund um den Bahnhof Zoologischer Garten hängen riesige Plakate der Serie. Aufgrund der anhaltenden Popularität der Thematik ist sie sowieso von vornherein in aller Munde – egal, wie schlecht die Umsetzung ist, an Christiane Felscherinows Lebensgeschichte lässt sich verdammt gut verdienen. Währenddessen zog sich diese 2013 aus der Medienwelt zurück und hängt Berichten zufolge am Kottbusser Tor herum. Unser »Sozialstaat« bekommt es immer noch nicht hin, Drogenkonsument*innen zu entkriminalisieren und ihnen Hilfe und Perspektiven statt Geld- und Gefängnisstrafen zu bieten. Aber egal, Hauptsache, man* hat Spaß mit der Gang in Berlin.
Beitragsbild: © Constantin Film/Television