Wohnsinn-Kolumne: Bin ich noch da?
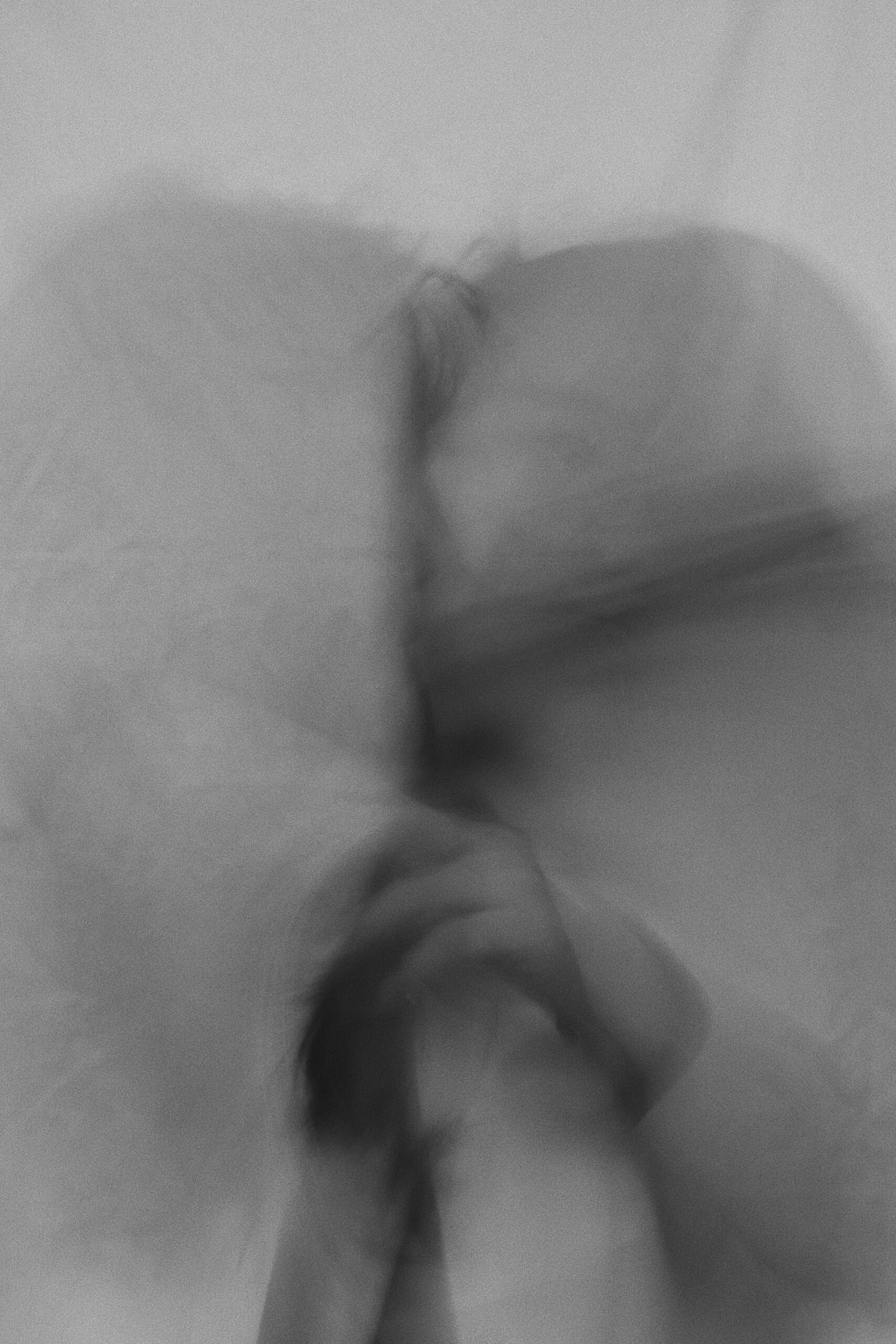
Sorry, Lotte. Es wird vielleicht nicht ganz so lyrisch diese Woche, aber dafür nicht unbedingt locker-flockig-luftig-leichter. Tut mir leid … mit Chick-Flick-Stimmung kann ich nicht dienen. Ist sowieso was für’n Sommer und ja, ok … es wird schon wärmer. Kalt ist es trotzdem noch manchmal.
von Anna-Lena Brunner
Manchmal habe ich das Gefühl, ich löse mich auf. Kleine Partikel von mir fangen an zu flirren und steigen nach oben. Schwerkraft, nein danke. Haarschuppen, Hautschuppen, Sommersprossen. Alles schwimmt nach oben. Wie bei Marta und Jonas in der letzten Folge von »Dark«.
Das passiert ganz unerwartet. Beim Frühstücken, in der Dusche, mit Freund*innen abends beim Quatschen. Mein Herz kommt da nicht nach mit der Auflösung und es fängt an zu rasen. Ich versuche, mich festzuhalten und halte mich an meinen Armen fest. Aber es hilft nicht. Ich muss raus. Raus aus meinem Zimmer, raus aus dem Leben, raus aus meinem Körper?
Irgendwann schaff’ ich’s dann wieder rein und mein Ich kommt langsam zurück zu mir. Was ist das Gegenteil von auflösen? Zusammenfügen? In solchen Momenten weiß ich das nicht. Aber da weiß ich vieles nicht. Was ich auch lange nicht wusste: Dieses Gefühl ist nicht nur eine wirre Spinnerei, die sich durch meine Gehirnwindungen schlängelt und mit Sätzen wie »Reiß dich mal zusammen!« oder »Spinn doch nicht so rum!« behoben werden könnte. Dieses Gefühl hat einen Namen: Panikattacke.
Die Welt führt in einem Artikel von 2015 eine Studie an, bei der nachgewiesen wurde, dass 15 Prozent der Deutschen aufgrund von Angstzuständen einen Arzt aufgesucht hätten. Bei einer Einwohner*innenzahl von um die 80 Millionen sind das 12 Millionen Menschen, die an einer Angststörung leiden oder zumindest deswegen schon einmal Hilfe in Anspruch nahmen. Das ist eine ganze Menge, gelinde gesagt. Nur wird das doch ziemlich todgeschwiegen meinem Empfinden nach. Ich habe tatsächlich noch nie mit jemandem darüber gesprochen, dem*der es genauso geht. Wieso eigentlich nicht?
Vielleicht weil das neue »stark« jetzt »mutig« heißt. Es ist ok, verletzlich zu sein, sich verwundbar zu zeigen und mal nicht so gut drauf zu sein. Und das ist auch richtig gut so, weil es ja auch wirklich ok ist. Aber ängstlich zu sein? Und auch noch ohne Grund? Weird. In Zeiten, in denen das Instagrampic vom Sprung von der zehn-Meter-Klippe auf Bali ins kühle Nass das neue Statussymbol to have ist, scheint es einfach nicht so hipp zu sein, wenn man* gerade in der Küche sitzt und zittert. Und man* einfach nicht weiß wieso.
Was dann hilft? Festhalten. Irgendetwas greifen, das mich daran erinnert, dass ich noch da bin. Ein Buch, eine runtergebrannte Kerze, die Hand meiner Mitbewohnerin. Wände helfen auch. Die hindern mich daran, wegzufliegen (um jetzt hier auch mal eine elegante Kurve zum eigentlichen Thema Wohnen zu schlagen).
Eine liebe Freundin saß mir letztens gegenüber. Etwas verkatert tranken wir Kaffee und rauchten eine Zigarette. Auf einmal fährt sie sich über’s Gesicht und sagt: »Das muss ich manchmal machen, damit ich weiß, dass ich noch da bin.« Ich schmunzelte leise in mich hinein. Vielleicht ist das ja das Gegenteil von auflösen. Verbunden sein.
Nächste Woche wird’s wieder kälter. Also draußen. Im Wohnsinn von Verena aber hoffentlich etwas kuschelig-wärmer!






